|

Auf Einladung
der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit las Lea
Fleischmann im Alten Rathaus Göttingen.
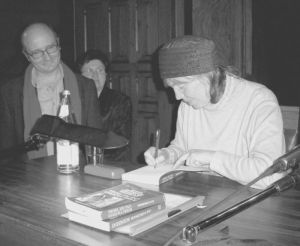
Nach der Lesung signierte die
Autorin ihre Bücher und stellte sich den Fragen des Publikums. |
Schriftstellerin Lea Fleischmann zu Gast in Göttingen
Göttingen. Lea Fleischmann ist
eine Grenz- und Kulturenwanderin. Die Israelin wurde 1947 in Ulm geboren,
ist in Deutschland aufgewachsen und hat als Displaced Person mit
entwurzelten Eltern die Nachkriegszeit erlebt. Später war sie Lehrerin an
einer deutschen Schule. Doch dann kam der Bruch mit Deutschland, aber
nicht mit der deutschen Sprache.
Aus bisher unveröffentlichten Texten über ihre Jugend in Deutschland und
zum Terror in Israel, aus ihren Büchern zum Schabbat und über „Rabbi
Nachman“ las Fleischmann auf Einladung der Gesellschaft für
christlich-jüdische Zusammenarbeit Göttingen im Alten Rathaus. Die
Veranstaltung fand im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit statt.
Anschaulich beschreibt Fleischmann die bedrückende Atmosphäre im Lager
der Nachkriegszeit und die Jugend in einer sprachlosen Familie, in der
„dumpfes Schweigen“ und der Hass auf alles Deutsche den Alltag bestimmten.
Später, während des Studiums in Frankfurt am Main, lernt sie die linke
Studentenszene kennen und fühlt sich aufgehoben bei Diskussionen und
Visionen im verrauchten Club Voltaire, einer „Insel der Freiheit“. In
Israel sucht die Ausgewanderte lange nach einer ähnlich ungezwungenen
Geborgenheit.
Sie findet sie nicht im Straßencafé, sondern in der Lernstube „Frohes
Licht“.
Im grauen, strengen Kostüm mit rot-braunem Hut sitzt Lea Fleischmann
aufrecht am Lesetisch. Sie liest mit ruhiger, singender Stimme, spricht
akzentuiert und formuliert sehr überlegt. Bei der Textstelle über die
Entdeckung der jüdischen Religion lächelt sie. Lea Fleischmann beschreibt,
wie sie den Schabbat begeht. „Der Schabbat“, sagt sie, „ist ein großes
Geschenk, das mir Jerusalem gemacht hat.“ Mit ihren Kindern zelebriert sie
den Tag, an dem weder Medien noch Telefon die Ruhe stören. Doch auch in
den Schabbat hinein bricht der Alltag in Israel mit seinem Terror.
Fleischmann schildert Trümmer und Scherben, Leid und Tod. Sie habe
erkannt, dass ihr Leben nicht in ihrer Hand läge - das habe ihr die Angst
genommen.
Doch in ihren Texten kommt nur die israelische Seite vor, kein Wort über
Vorgeschichte der Anschläge oder die Ansprüche der Palästinenser. Früher
habe sie auf Versöhnung gehofft, sagt Fleischmann. Doch jetzt sei auf der
Gegenseite, bei den Palästinensern, kein Gesprächspartner zu finden. Sie
appelliert an die Europäer, mit der Hilfe für die Palästinenser immer die
Forderung nach demokratischen Strukturen und freien Wahlen zu verbinden.
Mit Arafat sei kein Frieden möglich. Sie werde Sharon wählen, weil er
derjenige sei, der nicht mit Arafat reden wird.
(Verena Leidig) |